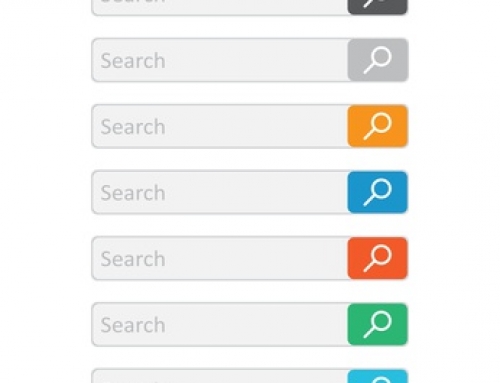Evidence based data, Patientenbeteiligung & Patientenpräferenz – sind evidente Daten machbar?

Zusatznutzen – eine einfache Gegenrechnung?
Die Entwicklung neuer Arzneimittel schreitet kontinuierlich voran, mit dem steten Ziel, die Situation des Patienten zu verbessern, ja im besten Falle, den Patienten zu heilen. Der erhoffte Zusatznutzen eines jeden neuen Arzneimittels wird in Deutschland dabei anhand der Kategorien Mortalität, Morbidität, Verträglichkeit und Lebensqualität bestimmt, wobei Effekte innerhalb dieser Kategorien am Ende des Bewertungsverfahrens weitestgehend ungewichtet gegeneinander „verrechnet“ werden1.
Diese scheinbar einfache Gegenrechnung nutzentragender Parameter wirft bei näherer Betrachtung eine Reihe an Grundsatzfragen auf. Ist ein weiteres Jahr unter ggf. starken Nebenwirkungen überhaupt erstrebenswert? Wenn man die Wahl zwischen Diarrhöe oder verringertem Blutdruck hat, was ist das „kleinere Übel“?
Häufig werden für diese und ähnliche Fragestellungen Experten zu Rate gezogen. Aber kann ein Mensch, der nicht direkt von der krankheitsspezifischen Situation betroffen ist, solche ethisch kritischen Bewertungen überhaupt vornehmen?
Die Divergenz von Patientenpräferenzen in Abhängigkeit der Lebenssituation
In einem Pilotprojekt des IQWiG zur Indikation Depression wurde genau dieser Fragestellung nachgegangen2. Die Untersuchung ergab, dass sich Präferenzen von Experten und betroffenen Patienten hinsichtlich verschiedener Nutzenparameter zum Teil sehr deutlich unterscheiden.
So wird beispielsweise das Ansprechen auf eine Therapie (definiert als mindestens Halbierung der vom Patienten berichteten depressiven Symptomen) von Patienten in seiner Bedeutsamkeit deutlich höher gewichtet als eine Remission (definiert als Symptomfreiheit).
Ganz anders bewerteten dies die Experten, die einer Remission viel größere Bedeutung beimessen, als dem Therapieansprechen.
Dies zeigt, dass der Kontext, also die Lebenssituation, in der sich der jeweilige Befragte befindet, bei der Bewertung von Patientenpräferenzen eine sehr zentrale Rolle spielt.
Die Stimme des Patienten hören und einbringen
Während sich in Deutschland Experten noch mit der Machbarkeit und Methodik für mehr Patientenbeteiligung beschäftigen, ist man in den USA schon einen Schritt weiter. Innerhalb der FDA wurde dort bereits ein Beratungsausschuss zur Stärkung der Patientenbeteiligung im Bereich Medizinprodukte gegründet3, der das Ziel verfolgt, die Sicht des Patienten stärker in die Produktentwicklung und die regulatorischen Prozesse einzubringen.
Auch in Deutschland mehren sich die Bestrebungen nach mehr Patientenbeteiligung im Zuge der Arzneimittelentwicklung und -bewertung. Dazu fand am 10.12.2015 ein Symposium zum Thema „Evidenzbasierte Patientenbeteiligung – Warum haben wir keine Daten?“, statt4. Im Rahmen des von Prof. Dr. Axel Mühlbacher organisierten Symposiums diskutierten Beteiligte aus Institutionen der Politik (G-BA), Patientenvertretungen (BAG Selbsthilfe), Pharmaindustrie sowie Forschung (IQWIG, Universitäten) rund um das Thema Patientenpräferenzen und brachten ihre Ideen, wie mehr verlässliche Daten von Seiten des Patienten gesammelt werden können, vor.
Dass Daten hinsichtlich Patientenpräferenzen fehlen und wichtig sind, darin sind sich alle Stakeholder einig. Die Umsetzbarkeit und Methodik, insbesondere im Hinblick auf Subgruppen (z.B. Patienten mit verschiedenen Schweregraden einer Erkrankung), hingegen bleibt strittig.
Während einige Parteien, wie zum Beispiel die organisierte Patientenvertretung und auch einige Vertreter aus der Gesundheitsökonomie, gerne zunächst weiter an den methodischen Ansätzen zur Patientenbeteiligung feilen würden, schlägt Prof. Dr. Windeler (IQWIG) vor, möglichst bald mit der Bearbeitung solcher Fragestellungen loszulegen und Daten zu generieren.
Patientenpräferenzen im Zuge der frühen Nutzenbewertung nutzen?
Auch inwieweit Studien zu Patientenpräferenzen Verwendung in der frühen Nutzenbewertung von Arzneimitteln finden könnten, bleibt diskussionswürdig.
Derzeit stellt sich z.B. bei Produkten, die zwar eine eindeutige Verbesserung des Überlebens zeigen, jedoch auch beträchtliche Nebenwirkungen aufweisen, die Frage, ob ein beträchtlicher Zusatznutzen grundsätzlich gerechtfertigt wäre.
Um hier ein klares Urteil fällen zu können, ist die Sicht des betroffenen Patienten hochrelevant, denn nur so könnte eine patientenorientierte Gewichtung der Effektmaße in den einzelnen Kategorien erfolgen (z.B. Inkaufnahme von Nebenwirkungen um ein längeres Überleben zu erreichen).
So betont der G-BA, dass bei nicht eindeutiger Bewertung des Zusatznutzens innovativer Arzneimittel zusätzliche Informationen hinsichtlich Patientenpräferenz als „Zünglein an der Waage“ für eine Entscheidung dienen könnten. Aus Sicht von G-BA und IQWIG ist zudem klar, dass Patientenpräferenzen nicht dazu verwendet werden sollten, paraklinische Endpunkte bzw. Surrogatparameter in patientenrelevante Endpunkte zu transformieren.
In Verbindung mit Patientenpräferenzen können Surrogatendpunkte jedoch wertvolles Wissen zu derzeit „schwarzen Löchern“ generieren, wie das der psychologischen Beeinflussung des Patienten durch z.B. bestimmte, klinisch relevante Laborwerte. Beruhigt beispielsweise das Wissen um eine niedrige Viruslast und verbessert damit den Allgemeinzustand eines Patienten?
Klar ist: die Erhebung von Patientenpräferenzen muss unter der Prämisse Neutralität stehen. Eine randomisierte klinische Studie ist daher aus methodologischer Sicht oft nicht die geeignete Wahl für die Erhebung derartiger Daten.
Zunächst befinden sich Patienten in einer klinischen Studie in einer Art Ausnahmesituation, die bei weitem nicht dem realen Versorgungsalltag entsprechen muss.
Des Weiteren werden in klinischen Studien möglicherweise nicht alle Endpunkte erhoben bzw. abgebildet, die dem betroffenen Patienten tatsächlich wichtig sind und daher einem „wahren“ Patientennutzen entsprächen.
Zuletzt kann nicht ausgeschlossen werden, dass allein die Teilnahme an einer Studie mit einer veränderten Sichtweise des Patienten einhergeht, bzw. die Studienprozeduren einen Einfluss auf die Bewertung der Präferenzen des Patienten haben.
Um gerade diese „Unbekannten“ zu identifizieren, sind im ersten Schritt Befragungen von sogenannten Fokusgruppen hilfreich. Die hier identifizierten Endpunkte können anschließend in einer größeren Befragung Betroffener bewertet werden.
Für evidenzbasierte Daten fehlt schlichtweg die Zeit
Die Erhebung von Patientenpräferenzen ist somit nicht trivial oder schnell durchzuführen. Genau vor diesem Problem stehen die Mitglieder der organisierten Patientenvertretung im Rahmen der frühen Nutzenbewertung, wo sie in beratender Funktion als „Sprachrohr“ der Patienten fungieren.
Leider finden hier in der Regel derzeit jedoch nur subjektive Meinungen der jeweiligen Vertreter im Rahmen der offiziellen Stellungnahme Platz – für wissenschaftlich fundierte Studien und damit evidenzbasierte Daten fehlt in der Eile des Verfahrens schlichtweg die Zeit.
Wünschenswert und sinnvoll wäre im ersten Schritt eine Sammlung zu Patientenpräferenz-Studien über viele Indikationen unter Berücksichtigung der wichtigsten Subgruppen, welche häufig schon vor Studienplanung absehbar sind.
Picture: @tai111 /Fotolia.com
- Bleß H-H, Keller C. AMNOG: Chronische Erkrankungen – Hürden und Hemmnisse im Verfahren der frühen Nutzenbewertung für Arzneimittel zur Behandlung chronischer Erkrankungen., 2013
- Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Analytic Hierarchy Process (AHP) – Pilotprojekt zur Erhebung von Patientenpräferenzen in der Indikation Depression. IQWiG-Berichte – Nr 163 [Internet], 2013.
- U.S. Food and Drug Administration (FDA). Patient Engagement Advisory Committee. 2015.
- Prof. Dr. Axel Mühlbacher. Evidenzbasierte Patientenbeteiligung – warum haben wir keine Daten?